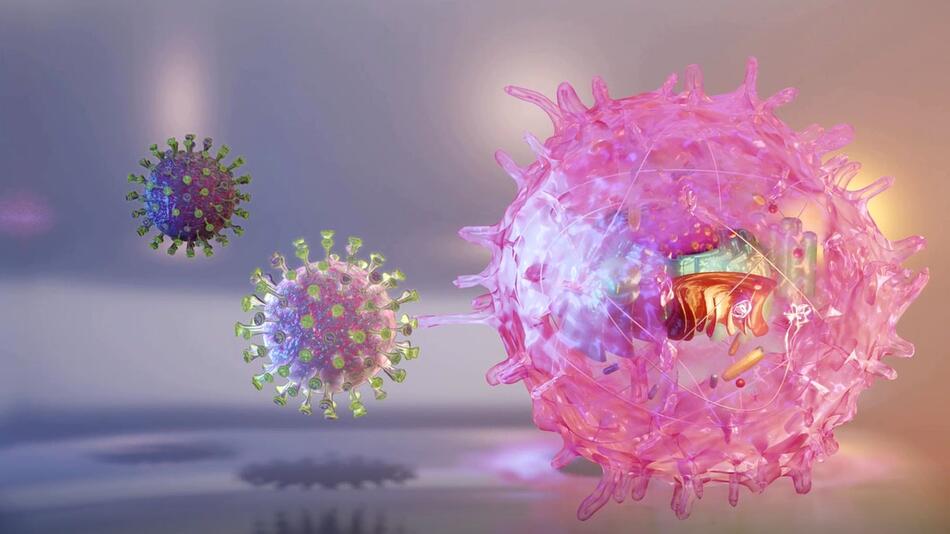Vor fünf Jahren brachte ein Germanwings-Pilot sein Flugzeug in den französischen Alpen zum Absturz. Nach dem Unglück wollten Politiker und Fluggesellschaften schnell handeln und den Vertrauensverlust in die Piloten kompensieren und ähnliche Unglücke verhindern. Manche Änderungen erwiesen sich als sinnvoll, andere als unpraktikabel – und wurden mittlerweile wieder abgeschafft. Ein Überblick.
Im französischen Digne-les-Bains war für Dienstag ein trauriges Jubiläum geplant. Familien aus dem nordrhein-westfälischen Haltern, aus Frankreich und Spanien wollten gemeinsam der 150 Opfer des Germanwings-Fluges gedenken, der am 24. März 2015 in den französischen Alpen abgestürzt war.
Anlässlich des fünften Jahrestags von Flug 4U9525 war eine aufwendig geplante Gedenkfeier geplant. Doch das Coronavirus machte auch vor Digne-les-Bains nicht halt – vergangene Woche haben die französischen Behörden und die Lufthansa die Gedenkveranstaltung abgesagt. Nun soll nur noch eine ökumenische Messe stattfinden, für die Opfer wird – wie jedes Jahr - ein Kranz niedergelegt.
Germanwings 4U9525: Absturz in den französischen Alpen
Auf den Tag genau fünf Jahre ist es nun her, dass Andreas Lubitz, Erster Offizier auf dem Germanwings-Flug von Barcelona nach Düsseldorf, den Airbus A320 mit der Registrierung D-AIPX in die französischen Alpen steuerte. Der damals 27 Jahre alte Pilot hatte den Flugkapitän nach einem Toilettengang aus dem Cockpit gesperrt und den Autopiloten auf Sinkflug programmiert.
Dass die Cockpittür als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 verstärkt und für unerwünschte Eindringlinge unüberwindbar geworden war, erwies sich als tödlich. Der Kapitän hatte keine Chance, den Absturz zu verhindern.
In der Luftfahrt hat es Tradition, dass besondere Vorkommnisse – vom Parkschaden bis zum Absturz – von den Behörden akribisch aufgearbeitet werden. Am Ende stehen ausführliche Flugunfallberichte, die in der Regel mit Verbesserungsvorschlägen oder Auflagen für Behörden, Fluggesellschaften oder Hersteller gespickt sind.
Meistens führen technische Defekte oder menschliches Versagen zum Absturz. Im Falle von Germanwings-Flug 4U9525 stand die Unglücksursache schnell fest. Die Ermittlungsbehörden sehen es heute als erwiesen an, dass der Erste Offizier Andreas Lubitz den Airbus bewusst in die Berge steuerte.
Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht?
Bereits während seiner Ausbildung soll er unter Depressionen gelitten haben, Ärzte attestierten ihm später eine "psychosomatische Störung und eine Angststörung". Lubitz soll Sorge gehabt haben, seine "Berechtigung als Verkehrspilot zu verlieren, wenn er seine Einschränkung der medizinischen Tauglichkeit einem flugmedizinischen Sachverständigen gemeldet hätte", steht im Untersuchungsbericht.
Lubitz' Arbeitgeber soll von seinen Depressionen nichts gewusst haben. In ihrem Resümee geben die Ermittler deshalb auch den deutschen Behörden eine Teilschuld. Es habe vor 2015 an klaren Richtlinien gefehlt, "wann eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit schwerer wiegt als Gründe für die ärztliche Schweigepflicht".
Die französische Fluguntersuchungsstelle BEA forderte "klare Regeln, die (…) den Gesundheitsdienstleister auffordern, die Behörden zu informieren, wenn die Gesundheit eines Patienten höchstwahrscheinlich die öffentliche Sicherheit gefährdet."
Bald entbrannte eine Diskussion, ob die ärztliche Schweigepflicht bei risikoreichen Berufen gelockert werden müsse. Sollten Ärzte an die Behörden melden, wenn ihre Patienten, die als Piloten, Lokführer oder Polizisten arbeiten, depressiv sind? Ein solches Gesetz öffne die Büchse der Pandora, das Ärzte-Patienten-Verhältnis stehe auf dem Spiel, argumentierten Ärzte und betroffene Berufsgruppen – und setzten sich durch. Eine Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht war bald vom Tisch.
Gezielte Fragen nach psychischer Gesundheit
Dennoch habe sich seit dem Germanwings-Absturz einiges getan, sagt Jakob Wert, Luftfahrtspezialist und Chefredakteur von International Flight Network. "Beispielsweise müssen jetzt Fluggesellschaften bei der Einstellung von Piloten deren Eignung überprüfen." Viele Airlines hätten zudem Unterstützungsprogramme eingeführt, bei denen man sich bei psychischen Problemen freiwillig melden kann. Die Unfallermittler hatten solche Programme in ihrem Bericht explizit gefordert.
Medizinisch mussten sich Piloten schon vor dem Germanwings-Absturz mindestens einmal im Jahr durchchecken lassen. Auf dem Programm stehen klassische Tests wie die Untersuchung von Blut, Augen und Urin. Auf ihre psychische Eignung wurden die Piloten bei den meisten Airlines vor 2015 jedoch nur bei der Einstellung überprüft. Piloten, die im Laufe ihrer Karriere psychische Probleme entwickelten, blieben unentdeckt. Damit sollte nach Flug 9525 Schluss sein. Bei den jährlichen medizinischen Check werden die Cockpit-Besatzungen nun mit gezielten Fragen konfrontiert, die Aufschluss über den psychischen Zustand geben sollen.
Neu sind auch sogenannte ADM-Kontrollen, also Schnelltests vor dem Flug, die bei Alkohol, Drogen und Medikamenten anschlagen. Kurz nach dem Absturz wurde das Luftverkehrsgesetz dahingehend geändert, dass Airlines "vor Dienstbeginn verdachtsunabhängige Kontrollen in Form von Stichproben" durchführen müssen. Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass Piloten angetrunken fliegen, aber auch, dass das fliegende Personal unbemerkt Medikamente wie Antidepressiva einnehmen kann.
Zwei-Mann-Regelung wurde wieder abgeschafft
Längst nicht jede Änderung, die nach dem Unglück im Hauruckverfahren beschlossen wurde, hat bis heute Bestand. Besonders eine Empfehlung wurde von den Piloten hart bekämpft. Die BEA hatte kurz nach dem Absturz die Einführung einer sogenannten "Minimum Cockpit Occupancy" gefordert.
Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich im Grundsatz, dass das Cockpit zu jeder Zeit von zwei Besatzungsmitgliedern besetzt werden muss. Sollte beispielsweise ein Pilot das Cockpit für einen Toilettengang verlassen, müsste sich ersatzweise ein Flugbegleiter vorne aufhalten. Viele Airlines verpflichteten sich nach dem Absturz zu dieser Maßnahme, in Deutschland auch die Lufthansa.
Doch die Regelung wurde schnell als unpraktikabel angesehen. So kritisierte die Vereinigung Cockpit (VC), dass die "Anwesenheit einer nicht in Flugverfahren geschulten Person weitere Risiken birgt und sich operationelle Probleme sowohl im Cockpit durch den Wechsel sowie durch die Abwesenheit in der Kabine für Safety und Serviceaufgaben mit sich" bringe. Insbesondere bei Kurzstreckenflügen, die häufig mit der Mindestanzahl von Flugbegleitern durchgeführt werden, wird in der Kabine jede Arbeitskraft gebraucht.
Auch Sicherheitsexperten bezweifelten die Wirksamkeit. "Wie die Zwei-Mann-Regel gezeigt hat, ist die naheliegendste Lösung nicht unbedingt die sicherste", sagt Luftfahrtexperte Wert. "Durch den Personalwechsel steht die Tür länger offen als normal, wodurch es wiederum leichter wird, in das Cockpit einzudringen". Das Entführungsrisiko bleibe größer als das Suizidrisiko. Am Ende sahen es die meisten Airlines ähnlich: Zwei Jahre nach der Einführung wurde die Zwei-Mann-Regelung wieder abgeschafft. "Experimentelle Veränderungen sind nicht die Lösung", sagt Jakob Wert.
Fest steht: Fünf Jahre nach dem Absturz hat sich für das fliegende Personal einiges geändert. Maßnahmen wie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 blieben jedoch aus.
Verwendete Quellen:
- Interview mit Jakob Wert, Chefredakteur von International Flight Network
- Luftfahrt-Bundesamt - Handbuchergänzungen bzgl. verdachtsunabhängigen Kontrollen gem. § 4a LuftVG
- Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) – Abschlussbericht
- 18. Deutscher Bundestag - Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes
- Gesetze im Internet – Luftverkehrsgesetz §4a


"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.